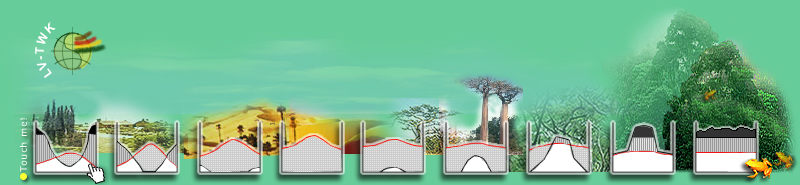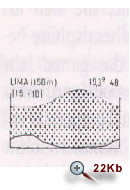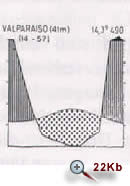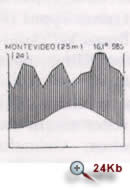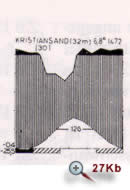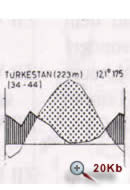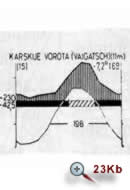| |
 |
 |
 |
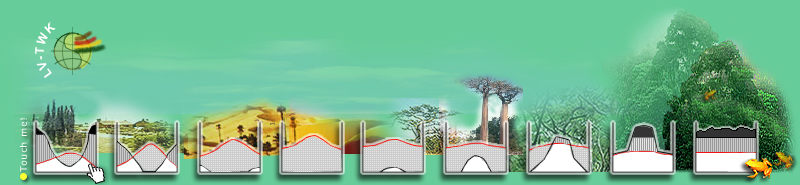 |
|
Vegetationsökologie
Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)
|
| |
|
|
|
|
|
ZM17
|
|
|
|
S.
A6
|
Ökozonen
bzw. Zono-Biome - Teil 2 ...
 |
|
| |
|
 |
Ökozonen
(nach SCHULTZ 2000, S.26-27) |
| |
|
| |
 Tab.
A-6/01:
Tab.
A-6/01:
|
| |
|
Ökozonen
|
N-Amerika
|
Eurasien
|
S-
und
Mittelamerika
|
Afrika
|
Australien
(mit Neuseeland)
|
 Polare/ Polare/
Subpolare Zone |
In
Kanada vom arktischen Archipel bis zum Südende der Hudson
Bay (Barren Grounds, Labrador); Norden und Westen von Alaska. |
Arktische
Inseln und Island; etwa 300-500km breite Küstenzone nördlich
desPolarkreises in Skandinavien und Russland (haubptsächlich
in Sibirien) |
|
|
|
 Boreale
Zone Boreale
Zone |
Etwa
700 km breiter Gürtel von Alaska bis Neufundland (grösster
teil Kanadas südlich der Tundren). |
1000
- 1500 km breiter Gürtel von Skandinavien bis Kamschatka
(grösster Teil von Sibirien südlich der Tundren). |
|
|
|
 Feuchte
Mittelbreiten Feuchte
Mittelbreiten |
Westküste
von Oregon bis Kanada sowie der NO der USA (etwa östl.
von 95 Grad W u. nördl. von 36 Grad N) und benachbarte
Gebiete von kanada (Montreal). |
W-,
Mittel-, und O-Europa bis ca. 1500 km östl. Ural (Nowosibirsk)
sowie NO-China (Mandschurei, Beijing [Peking]), Korea (ausser
Süden) und N-Japan. |
Südliches
Chile (Westpatagonien, 'Kleiner Süden') |
|
SO-Australien
(Melbourne) und Tasmanien; Südinsel von Neuseeland. |
  Trockene
Mittelbreiten Trockene
Mittelbreiten |
Great
Plains von Saskatchewan und Alberta in Kanada bis Texas in den
USA (etwa westl. von 95 Grad W) sowie Grosses Becken. |
Teilweise
über 2000 km breiter innerkontinentaler Gürtel von
der Ukraine bis zur Wüste Gobi und der Mongolei. |
Südliches
Argentinien (Ostpatagonien). |
|
Neuseeland:
kleines Gebiet auf der O-Seite der Südinsel. |
  Winterfeuchte
Subtropen Winterfeuchte
Subtropen |
Küstennahe
Gebiete von Kalifornien. |
Breiter
saum am N- und O-Rand vom Mittelmeer, nach O bis in den Iran. |
Mittleres
Chile. |
N-Afrika:
Küstensäume von Marokko, Algerien und Tunesien; Cyrenaika
in Libyen:
S-Afrika: Kapregion. |
SW-Australien
(Perth) und SO-Australien (Adelaide). |
  Immerfeuchte
Subtropen Immerfeuchte
Subtropen
|
SO-der
USA, etwa bis 36 Grad N und westl. bis zur Langgrassteppe von
Texas. |
Mittleres
China (südl. 32 Grad N), südl. Hälfte von Japan
(nordw. bis etwa 37 Grad N). |
S-Staaten
von Brasilien (Sao Paulo, Parana, Sta. Catarina u. Rio Grande
do Sul), östl.Pampa von Argentinien und Uruguay. |
Östl.
Teile von S-Afrika: Natal, Transkei, östl. Kapregion |
Küstenzone
und Great Dividing Range von O-Australien, etwa zwischen 23
und 37 Grad S, Nordinsel von Neuseeland. |
  Tropisch/ Tropisch/
subtropische Trockengebiete |
vgl.
S- und Mittelamerika! |
Naher
Osten, Pakistan und NW-Indien. |
Mittelamerika:
Sonora und Chihuahua Wüste (von N-Mexiko bis in den SW
der USA);
S-Amerika: Caatinga in NO-Brasilien, Gran Chaco und Monte in
Paraguay und N-Argentinien; Atacama in Chile und Peru. |
N-Afrika:
Sahara, Sahel;
E-Afrika: von Somalia bis nach N-Tansania;
S-Afrika: Namib, Kalahari und Karoo;
SW-Madagaskar (Toliara). |
Australien
ausser den mehr oder weniger breiten Küstenregionen im
Norden, Osten, Süden und Südwesten. |
  Sommerfeuchte
Tropen Sommerfeuchte
Tropen |
|
Östliches
und südöstliches Indien, Thailand, Kambodscha, Vietnam
und äusserster Süden von China. |
Mittelamerika:
grösste Teile von Mexiko;
S-Amerika: Llanos del Orinoco, Campos cerrados (grösste
Teile von Brasilien südl. des Amazonasbeckens). |
Sudan
Zone (südl. des Sahel); grosse Teile von O- und Zentralafrika
(südl. des Kongobeckens); mittleres Madagaskar. |
Nördlichste
Teile von Australien (Arhem Land, York Halbinsel). |
  Immerfeuchte
Tropen Immerfeuchte
Tropen |
|
Grösste
Teile von Sri Lanka, Burma, Malaysia, Indonesien, Philippinen
und Neuguinea. |
Mittelamerika:
von Chiapas (S-Mexiko) bis Panama; die grössten Anteile
der Karibischen Inseln.
S-Amerika: Amazonasbecken, Küstenregionen in SO-Brasilien
(Rio de Janeiro) |
Guinea
Zone (südl. der Sudan-Zone) in W-Afrika; Kongobecken in
Zemtralafrika; Ostseite von Madagaskar. |
|
|
 |
|
 |
|
| |
|
 |
Zono-Biome
(nach WALTER 1973, S.25/26) |
| |
|
 |
 Tab.
A6-02: Tab.
A6-02:
|
| |

Klimazonen
als
Zonobiome
|
|

Typische
Klimadiagramme
Zum
Zoomen der weiteren Beispiele bitte Lupen anklicken! |
 I.
Äquatoriale Zone I.
Äquatoriale Zone |
Etwa
zwischen dem 10. Breitengrad N und S mit einem Tageszeitenklima,
d.h. die Tagesschwankungen der Temperatur sind grösser
als die Jahresschwankung der Tagesmittel, die das ganze Jahr
um 25 - 27 Grad C liegen. Der Jahresniederschlag ist meist hoch,
die Regenmaxima liegen zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche; doch
gibt es in dieser Zone auch einzelne aride Gebiete.
Beispiel Klimatypus I
Äquatoriales feuchtes Klima in Kolumbien (typisch), Kamerun
(trockener) und Australien (Übergangszone zu II) |
 |
  II.
Tropische Zone II.
Tropische Zone |
Nördlich
und südlich von I (etwa bis zu 30 Grad N und S) mit bereits
merklichem Jahresgang der Tagesmittel der Temperatur; die Regenmaxima
verschieben sich in die Sommermonate und bilden schliesslich
ein Maximum zur Zeit des Zenitstandes der Sonne. Wir haben somit
eine Sommerregenzeit und eine Trockenzeit in
den kühlen (Winter-) Monaten. Diese wird mit zunehmender
Entfernung vom Äquator immer länger, zugleich nehmen
die Jahresniederschläge ab.
Beispiel Klimatypus II
Tropisches Klima mit Sommerregen in Brasilien, Südafrika
(schon mit Frösten) und Australien  |
 |
 III.
Subtropische Trockenzone III.
Subtropische Trockenzone |
Polwärts
vom 30. Breitengrad im Bereich der absteigenden Luftmassen,
die sich erwärmen und sehr trocken werden. Die Niederschläge
sind sehr gering, die Temperaturen am Tage infolge der starken
Einstrahlung sehr hoch; dagegen können sie nachts bei starker
Ausstrahlung in den Wintermonaten sogar unter Null sinken. Es
ist die Zone der Wüsten.
Beispiel Klimatypus III
Arides subtropisches Wüstenkliam in Peru (etwas Winterregen),
SW-Afrika (selten Sommerregen, oft Nebel) und Arabien (mit Winterregen) |
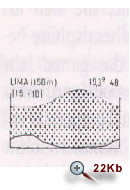 |
|
| |
|
 |
 |
| |
 Tab.
A6-03:
Tab.
A6-03: |
| |
|
| |
 |
 |
 |
 IV.
Übergangszone mit Winterregen IV.
Übergangszone mit Winterregen |
Um
den 40. Breitengrad herum, die im Sommer in die Zone des hohen
Luftdrucks und der trockenen Luft fällt, im Winter jedoch
bereits zyklonale Regen erhält. Es ist das typische Klima
des Mittelmeergebietes ohne kalte Jahreszeit, aber mit gelegentlichen
Frosteinbrüchen und einer langen Sommerdürre.
Beispiel Klimatypus IV
Etesienklima von mediterranem Typus in Chile, Südafrika
und Portugal |
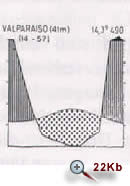 |
 V.-VIII.
Gemässigte Zonen V.-VIII.
Gemässigte Zonen |
Mit
zyklonalen Regen zu allen Jahreszeiten, die aber mit zunehmender
Entfernung vom Ozean abnehmen. Wir unterscheiden deshalb ein
feuchtes ozeanisches Klima und ein trockenes
kontinentales, bei dem zugleich die Sommer heisser
und insbesondere die Winter kälter werden.
Es handelt sich im einzelnen im folgende Klimagebiete: |
|
 V.
Warmtemperiertes Klima V.
Warmtemperiertes Klima |
Mit
wenig ausgeprägter, meist fehlender Winterkälte, grosser
Feuchtigkeit namentlich im Sommer.
Beispiel Klimatypus V
Warmtemperiertes und feuchtes Klima in Uruguay, Südafrika
und Türkei (Rize, Nord-Anatolien mit hohen Niederschlägen)
|
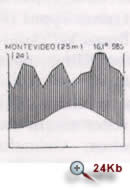 |
 VI.
Typisches gemässigtes Klima VI.
Typisches gemässigtes Klima |
Wie
z.B. in Mitteleuropa, mit einem kalten, aber nicht zu lange
anhaltenden Winter oder mit fast frostfreiem Winter, dann aber
sehr kühlem Sommer (extrem ozeanisch).
Beispiel Klimatypus VI
Gemässigtes Klima in Norwegen, Chile (sehr feucht, milde
Winter, aber kühle Sommer) und USA (kalte Winter, aber
heisse Sommer) |
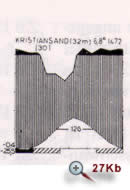 |
 VII.
Arides gemässigtes Klima VII.
Arides gemässigtes Klima |
Mit
kontinentalem Charakter, starken Temperaturgegensätzen
im Sommer und Winter und geringen Niederschlägen. Es ist
das Klima der temperaten Steppen.
Beispiel Klimatypus VII
Arides gemässigtes Klima in Zentralasien (Steppenlandschaften,
extrem kontinental und Halbwüste bis Wüste als VIIa
mit kalten Wintern, vgl. auch  Subzonobiome),
N-Amerika (Prärie), Argentinien (Pampa) sowie sehr kleines
Steppengebiet Neuseelands (ausgeglichener) Subzonobiome),
N-Amerika (Prärie), Argentinien (Pampa) sowie sehr kleines
Steppengebiet Neuseelands (ausgeglichener) |
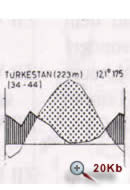 |
 VIII.
Boreales und kaltgemässigtes Klima VIII.
Boreales und kaltgemässigtes Klima |
Mit
kühlen und feuchten Sommern und kalten Wintern, die über
ein halbes Jahr andauern.
Beispiel Klimatypus VIII
Boreales kaltes Klima in Sibirien (extrem kontinental), Zentralrussland
und Schweden (ausgeglichener) |
 |
 IX.
Arktische Klimazone IX.
Arktische Klimazone |
Mit
geringen über das gesamte Jahr verteilten Niederschlägen,
aber trotzdem infolge der tiefen Temperaturen mit einem feuchten
kurzen Sommer ohne Nächte und sehr langem, kaltem und dunklem
Winter.
Beispiel Klimatypus IX
Arktisches Klima im Norden der UdSSR (kontinental), Norwegen
(feucht) und Argentinien (maritim) |
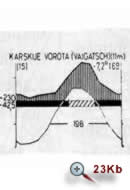 |
|
|
|
 |
 |
| |
|
| |
 Tab.
A6-04:
Tab.
A6-04: |
| |
|
| |
 |
 |
 |
ANMERKUNGEN
und
weitere
HINWEISE: |
Von dieser allgemeinen Zonierung kommen im einzelnen starke
Abweichungen vor:
Zunächst
ergeben sich asymmetrische Verhältnisse
zu beiden Seiten des Äquators. Durch das Überwiegen
der Meeresfläche auf der Südhemisphäre ist
das Klima dort allgemein kühler und ausgeglichener, d.h.
ozeanischer; die Zone III ist nur wenig ausgeprägt. Da
nur S-Amerika über den 40 Grad S hinausragt, nimmt die
gemässigte Zone nur eine kleine Fläche ein, die
boreale fehlt ganz und die antarktische ist fast nur durch
den vereisten antarktischen Kontinent vertreten.
Abweichungen
bedingen auch die planetaren Winde: Die Passate (NO-
und SO-Passate sind ursächlich trockene Luftmassen),
die äquatorwärts wehen, bringen keinen Regen, wenn
sie ablandig strömen und nicht auf Gebirge stossen (Steigungsregen);
dasselbe gilt von dem Monsun, der in O-Afrika über Festland
weht.
Andererseits
bringen Monsune (quasi eine Sonderform der Passatzirkulation
als Folge der Verlagerung
der ITC) -, aber auch Passate, die vom warmen Meer
her kommen - Regen, wie z.B. der Guinea-Monsun und die Monsunwinde
Indiens, Indonesiens und SO-Asiens.
Gebirgszüge
stören ebenfalls die Zonierung;
sie erhalten auf der Luvseite durch die Steigungsregen hohe
Niederschläge, während sie auf der Leeseite trocken
sind, ebenso wie das weite Tiefland im Windschatten.
Durch
das Zusammenwirken aller dieser Faktoren und weiterer lokaler
Einflüsse erklärt sich die Niederschlagsverteilung
auf der Erde und damit die Ausbildung klimatisch bedingter
ökologischer Zonen. Vgl. Sie die Abbildungen zu den
Biomen und Zono-Ökotonen unten! (aus Walter 1985,
Legende vgl. oben!)
|
|
| |
|
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
Ecological
zone breakdown used in Forest Resources Assessment (FRA) 2000 of FAO |
| |
|
| |
 Anmerkung:
Die folgende Ökologische
Zonierung durch FAO und WCMC ist von besonderer Bedeutung, da sie
mittlerweile international Verwendung findet!
Anmerkung:
Die folgende Ökologische
Zonierung durch FAO und WCMC ist von besonderer Bedeutung, da sie
mittlerweile international Verwendung findet! |
| |
|
| |
Source:
 Forest
Resources Assessment 2000 (FAO)
[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline] Forest
Resources Assessment 2000 (FAO)
[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline] |
| |
"ECOLOGICAL
ZONE MAP
The underlying strategy for the FRA ecological zoning reflected
both the thematic and technical needs of the map as well as the many
operational constraints that were expected in its development. In
terms of ecosystem principles, the map requirements were such that
zones or classes were defined and mapped using a holistic approach.
That is, both biotic and abiotic components of ecosystems were considered
in the zoning scheme. Beyond the thematic content and zoning, practical
aspects of digital cartographic production, such as data availability,
currency, scale and the associated reliability of the map inputs,
were also taken into account (Simons 2001).
FAO conducted two preliminary studies to identify specific
alternatives and constraints in the development of a global ecological
zone (GEZ) map appropriate for FRA 2000 purposes (Preto
1998; Zhu 1997). Findings from these studies, experience in
the development of the tropical ecological zone map for FRA 1990,
and recommendations from other parties consulted in the process indicated
that FAO could not complete an entirely new global ecological zoning
map by 2000 because of the large amount of scientific, organizational
and financial resources and time required. FAO therefore focused on
identifying an existing scheme that might be used or adapted to the
programme's needs. A Workshop on Global Ecological Zones Mapping,
held in Cambridge, United Kingdom in July 1999, and attended by experts
from 15 countries, helped set the framework.
Because of the enormity of conducting the work on a global scale,
a classification scheme had to be chosen that would meet FAO's
thematic requirements, be practical to construct with available resources
and meet the scrutiny of diverse users from all parts of the world.
Existing schemes were each developed for specific purposes according
to various environmental criteria. Macroclimate (temperature and
precipitation) was an element used by most (Preto
1998; WCMC 1992). Since macroclimate correlates well with the
potential vegetation associated with a particular locale, it was considered
a logical basis for the FRA ecological zoning as well."
|
| |
|
| |
 Tab.
A6-05:
Tab.
A6-05: |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| EZ
Level 1 - Domain |
EZ
Level 2 - Global Ecological Zone
|
|
Name:
|
Criteria
(equivalent to Köppen-Trewartha climatic groups)
|
Name
(reflecting dominant zonala vegetation)
|
Code
|
Criteria
(approximate equivalent of Köppen-Trewartha climatic types,
in combination with vegetation physiognomy, and one orographic
zone within each domain)
|
|
Tropical
|
All months
without frost: in marine areas over 18°C
|
Tropical
rain forest
|
TAr
|
Wet:
0-3 months dry,b during winter
|
|
Tropical
moist deciduous forest
|
TAwa
|
Wet/dry:
3-5 months dry, during winter
|
|
Tropical
dry forest
|
TAwb
|
Dry/wet:
5-8 months dry, during winter
|
|
Tropical
shrubland
|
TBSh
|
Semi-arid:
evaporation > precipitation
|
|
Tropical
desert
|
TBWh
|
Arid:
all months dry
|
|
Tropical
mountain systems
|
TM
|
Approximately
> 1.000m altitude (local variations)
|
|
Subtropical
|
Eight
months or more over 10°C
|
Subtropical
humid forest
|
SCf
|
Humid:
no dry season
|
|
Subtropical
dry forest
|
SCs
|
Seasonally
dry: winter rains, dry summer
|
|
Subtropical
steppe
|
SBSh
|
Semi-arid:
evaporation > precipitation
|
|
Subtropical
desert
|
SBWh
|
Arid:
all months dry
|
|
Subtropical
mountain systems
|
SM
|
Approximately
> 800-1000 m altitude
|
|
Temperate
|
Four
to eight months over 10°C
|
Temperate
oceanic forest
|
TeDo
|
Oceanic
climate: coldest month over 0°C
|
|
Temperate
continental forest
|
TeDc
|
Continental
climate: coldest month under 0°C
|
|
Temperate
steppe
|
TeBSk
|
Semi-arid:
evaporation > precipitation
|
|
Temperate
desert
|
TeBWk
|
Arid:
All months dry
|
|
Temperate
mountain systems
|
TM
|
Approximately
> 800 m altitude
|
|
Boreal
|
Up to
three months over 10°C
|
Boreal
coniferous forest
|
Ba
|
Vegetation
physiognomy: coniferous dense forest dominant
|
|
Boreal
tundra woodland
|
Bb
|
Vegetation
physiognomy: woodland and sparse forest dominant
|
|
Boreal
mountain systems
|
BM
|
Approximately
> 600 m altitude
|
|
Polar
|
All months
below 10°C
|
Polar
|
P
|
Same
as domain level
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
a
Zonal vegetation:
resulting from the variation in environmental, i.e. climatic, conditions
in a north-south direction.
b
A dry month is defined as the month in which the total
precipitation expressed in millimetres is equal to or less than
twice the mean temperature in degrees Centigrade.
However, a climatic
map showing such key features as temperature and precipitation is
not necessarily an ecological map until the boundaries are shown to
correspond to significant biological boundaries. Likewise, maps of
landform types (derived from digital elevation data) are not necessarily
ecological maps until it has been shown that the types co-vary with
other components of the ecosystem, such as vegetation (Bailey
1998).
For the choice
of climatic parameters to be used in the FRA 2000 map a number of
global systems were surveyed (Köppen 1931;
Trewartha 1968; Thornthwaite 1933; Holdridge 1947). Köppen
modified by Trewartha was selected as the best candidate because
of the number of classes that corresponded well to FRA 2000 needs.
Moreover, while Köppen-Trewartha is based on climate, there is a
demonstrated good correspondence between its subzones or climatic
types and the natural climax vegetation types and soils within them
(Bailey 1996).
FAO, in cooperation
with EDC and UNEP-WCMC, thus developed a prototype zoning scheme
for FRA 2000 based on Köppen-Trewartha. The zoning was made hierarchical
using Köppen-Trewartha's climatic groups and climatic types as FAO
ecological zone levels 1 and 2, respectively."
|
| |
Source:
 Forest
Resources Assessment 2000 (FAO)
[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline] Forest
Resources Assessment 2000 (FAO)
[date of access: 16.09.2005, mittlerweile offline]
|
| |
|
| |
LITERATURE
mentioned above:
Bailey, R.G. 1998. Ecoregion map of North America. USDA Forest
Service Publication No. 1548, Washington, DC.
Bailey,
R.G. 1996.
Ecosystem geography. New York, Springer Verlag.
Holdridge, L.R. 1947. Determination of world plant formations
from simple climatic data. Science, 105: 367-368.
Köppen. 1931. Grundrisse der Klimakunde. Berlin, Walter
de Gruyter Co.
Preto, G. 1998. A proposal for the preparation of the global
eco-floristic map for FRA 2000. Rome, FAO. (unpublished)
Simons, H. 2001. Global ecological zones mapping. FRA Working
Paper No. 56. Rome, FAO.
Thornthwaite, C.W. 1933. The climates of Earth. Geographic
Review, 23.
Trewartha, G.T. 1968. An introduction to weather and climate.
New York, McGraw-Hill.
WCMC. 1992. Global biodiversity: status of the earth's living
resources. London, Chapman & Hall.
Zhu, Z. 1997. Develop a new global ecological zone map
for GFRA 2000. Rome, FAO.
|
| |
|
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
A
n t e i l (in %) der Ökozonen an der Landfläche
der Erde
|
|
(nach Schultz, 1988) |
|
 Tab.
A6-06:
Tab.
A6-06: |
|
 |
 |
 |
|
Ökozonen
|
Anteil
der Zonen an der Landfläche
|
%
der
Gesamtfläche |
%
der
eisfreien Fläche
|
1.
Polare / subpolare Zone
1.1 Tundra und Permafrostzone
1.2 Eiswüsten |
14,8
3,9
10,9
|
4,4
4,4
-
|
| 2.
Boreale Zone |
13,0
|
14,7
|
| 3.
Feuchte Mittelbreiten |
9,7
|
10,9
|
4.
Trockene Mittelbreiten
4.1 Grassteppen (Prairien)
4.2 Wüsten und Halbwüsten |
11,0
8,0
3,0
|
12,3
8,9
3,4
|
5.
Tropische / subtropische Trockengebiete
5.1 Dornensavannen und -steppen
5.2 Wüsten und Halbwüsten |
20,9
9,2
11,7
|
23,4
10,1
13,3
|
| 6.
Winterfeuchte Subtropen |
1,8
|
2,0
|
| 7.
Sommerfeuchte Tropen |
16,3
|
18,3
|
| 8.
Immerfeuchte Subtropen |
4,1
|
4,6
|
| 9.
Immerfeuchte Tropen |
8,3
|
9,4
|
|
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
Weitere
Unterteilungen innerhalb der Vegetationszonen |
| |
|
| |
 Walter
grenzt aus seinen Zonobiomen auch noch die Orobiome
aus. Es sind Gebirgsgegenden, die wegen ihrer Höhe eine andere
Vegetation (oft extrazonale, d.h. klimaabhängige zonale
Vegetation, welche innerhalb einer anderen Vegetationszone vorkommt)
tragen. Walter
grenzt aus seinen Zonobiomen auch noch die Orobiome
aus. Es sind Gebirgsgegenden, die wegen ihrer Höhe eine andere
Vegetation (oft extrazonale, d.h. klimaabhängige zonale
Vegetation, welche innerhalb einer anderen Vegetationszone vorkommt)
tragen.
Eine nähere
Beschreibung  findet
sich hier! findet
sich hier!
|
| |
|
| |
 Pedobiome
sind Sonderstandorte mit speziellen Bodenausbildungen, z.B. dauervernässte,
salzige, sandige oder steinige Böden, welche eine azonale
(d.h. vom Klima unabhängige) Vegetation tragen. Sie wird weniger
durch das Makroklima als durch die speziellen Bodeneigenschaften geprägt
(siehe auch Anmerkung unten!). Pedobiome
sind Sonderstandorte mit speziellen Bodenausbildungen, z.B. dauervernässte,
salzige, sandige oder steinige Böden, welche eine azonale
(d.h. vom Klima unabhängige) Vegetation tragen. Sie wird weniger
durch das Makroklima als durch die speziellen Bodeneigenschaften geprägt
(siehe auch Anmerkung unten!). |
| |
|
| |
 Ergänzung: Ergänzung:
Der Begriff Biom kommt aus der
Landschafts- und Bioökologie. Er beschreibt grossräumige
- in der Regel einheitliche - Lebensräume, die als zusammengesetze
und verschiedene Ökosysteme funktionieren. Innerhalb dieser können
dann wieder Vegetationseinheiten (z.B. "Pflanzengesellschaften")
ermittelt werden. |
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
Probleme
bei der Bodenklassifikation |
| |
|
| |
Eine weltweit
gültige - und anerkannte - Ansprache von Böden existiert
(noch) nicht. Es ist wohl nicht übertrieben, von einem
- wenigstens teilweise - internationalen Chaos zu sprechen, was
es besonders für Nicht-Bodenkundler schwer macht, die unterschiedlichen
Bewertungen auf vorhandenen Kartenwerken miteinander zu vergleichen.
 Die neuesten Informationen zur
Die neuesten Informationen zur  Bodengeografie
und Bodenkunde sowie Systematik der Böden finden
Sie auf der Seite "Literatur und Hinweise zur VL-TWK"
Bodengeografie
und Bodenkunde sowie Systematik der Böden finden
Sie auf der Seite "Literatur und Hinweise zur VL-TWK"
 KLEINER
ÜBERBLICK: KLEINER
ÜBERBLICK:
 Einerseits
gibt es länderspezifische Klassifikationen, z.B. Einerseits
gibt es länderspezifische Klassifikationen, z.B.
- Deutschland
- Klassifikation der Geologischen Landesämter und der Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe, wie sie der Bodenkundlichen
Kartieranleitung zu Grunde liegt,
- Schweiz
- Bodenklassifikation der Schweiz nach Pallmann,
- USA - Soil
Taxonomy, etc.)
 und
jene, welche von internationalen Organisationen verwendet werden.
Dabei handelt es sich vornehmlich um die und
jene, welche von internationalen Organisationen verwendet werden.
Dabei handelt es sich vornehmlich um die
- FAO
 -Klassifikation - International Reference Base for Soil
Classification (IRB).
-Klassifikation - International Reference Base for Soil
Classification (IRB).
Eine weite Verbreitung - und einen grossen Einfluss - hat international
auch die in den USA entwickelte Soil Taxonomy (1975, 1994)
gefunden.
Der Natural Resources Conservation Service (NRCS) des United
States Department of Agriculture (USDA) stellt die  12
Ordnungen mit zahlreichen Unterordnungen der Soil Taxonomy, inkl.
jeweils ein Beispielprofil, im Internet vor. [date
of access: 21.06.04, leider mittlerweile offline] 12
Ordnungen mit zahlreichen Unterordnungen der Soil Taxonomy, inkl.
jeweils ein Beispielprofil, im Internet vor. [date
of access: 21.06.04, leider mittlerweile offline]
 Die
ursprüngliche - europäische - Systematik geht auf russische
Einteilungen zurück und berücksichtigt vor allem die
vegetationszonalen und klimatischen Parameter bei der Bodenbildung. Die
ursprüngliche - europäische - Systematik geht auf russische
Einteilungen zurück und berücksichtigt vor allem die
vegetationszonalen und klimatischen Parameter bei der Bodenbildung.
"In
diesem Jahrhundert setzten sich grundsätzlich die morphogenetischen
(oder pedogenetischen) Systeme durch, bei denen einerseits die
analytischen Merkmale eines Bodens sowie andererseits die Prozesse
der Bodenbildung und die Entwicklungsgeschichte im Vordergrund
stehen.
Eine dritte
Möglichkeit der Klassifikation besteht in der Verwendung
der analytischen Bodenmerkmale allein (unabhängig von der
Entstehung) als Kriterien. Diese Klassifikation wird von den USA
und etwas abgeändert von der FAO verwendet, und lässt
sich nicht problemlos mit unseren pedogenetischen Systemen parallelisieren.
(...)
 Zunehmend
wird (...) das Klassifikationssystem der FAO angewendet.
1998 wurde zudem von der International Society of Soil Science
des International Soil Reference and Information Centre ISRIC,
die sog. Zunehmend
wird (...) das Klassifikationssystem der FAO angewendet.
1998 wurde zudem von der International Society of Soil Science
des International Soil Reference and Information Centre ISRIC,
die sog. 'World
Reference Base for Soil Resources' (WRB) verabschiedet (als
'World
Reference Base for Soil Resources' (WRB) verabschiedet (als
 PDF-Datei
zum Herunterladen), die eine Modifikation des FAO-Systems darstellt."
(www.source: PDF-Datei
zum Herunterladen), die eine Modifikation des FAO-Systems darstellt."
(www.source:  Uni
Zürich, Bodenkunde) Uni
Zürich, Bodenkunde)
[date of access: 21.06.04, leider teilweise nicht mehr online]
 Bei
den, im Rahmen der LV TWK genannten Bodentypen, wird dem Klassifikationssystem
der FAO der Vorzug gegeben, gleichwohl versucht, auf entsprechende
Benennungen der US. Soil Taxonomy hinzuweisen. Bei
den, im Rahmen der LV TWK genannten Bodentypen, wird dem Klassifikationssystem
der FAO der Vorzug gegeben, gleichwohl versucht, auf entsprechende
Benennungen der US. Soil Taxonomy hinzuweisen.
|
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
Vergleich
von FAO-Bodeneinheiten mit der Klassifikation der US-Soil Taxonomy |
| |
|
| |
 Tab.
A6-07:
Tab.
A6-07: |
| |
|
| |
| FAO
Soil Units |
U.S.
Soil Taxonomy |
| Acrisols |
Ultisols |
| Andosols |
Andepts |
| Arenosols |
Psamments |
| Cambisols |
Inceptisols |
| Chernozems |
Borolls |
| Ferralsols |
Oxisols |
| Fluvisols |
Fluvents |
| Gleysols |
Aquic
Suborders |
| Greyzems |
Borolls |
| Histosols |
Histosols |
| Kastanozems |
Ustolls |
| Lithosols |
Lithic
Subgroups |
| Luvisols |
Alfisols |
| Nitosols |
Ultisols
and Alfisols |
| Phaeozems |
Udolls |
| Planosols |
-- |
| Podzols |
Spodosols |
| Podzoluvisols |
Glossic
Great Groups of Alfisols |
| Rankers |
Lithic
Haplumbrepts |
| Regosols |
Orthents,
Psamments |
| Rendzinas |
Rendolls |
| Solonchaks |
Salic
Great Group |
| Solonetz |
Natric
Great Group |
| Vertisols |
Vertisols |
| Xerosols |
Mollic
Aridisols |
| Yermosols |
Typic
Aridisols |
| |
|
| vgl.
Sie FAO
- Soil Unit Classification Scheme auf der Website
"GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in
der Helmholtz-Gemeinschaft und die Website Office
of Arid Lands Studies. |
|
| |
|
| |
www.source:
 Department
of Soil Science University of Wisconsin-Madison 1525 Observatory
> courses
Department
of Soil Science University of Wisconsin-Madison 1525 Observatory
> courses |
| |
[date
of access: 21.06.04] |
| |