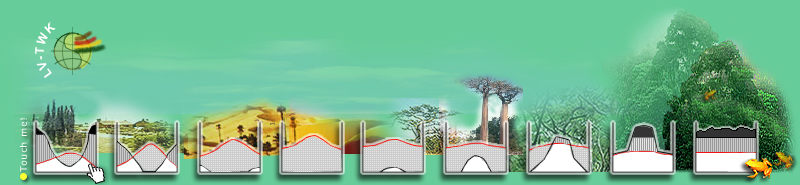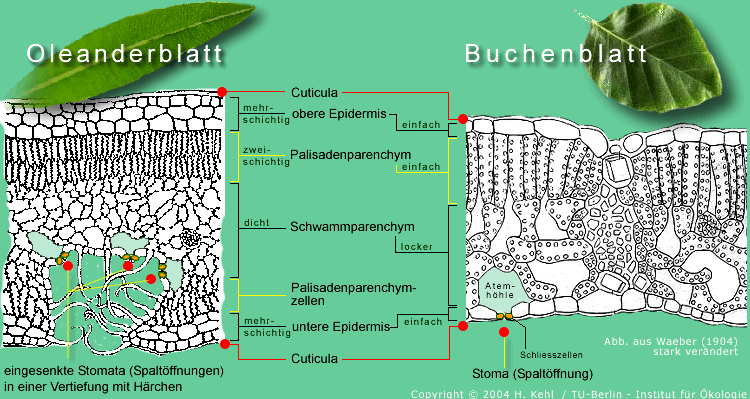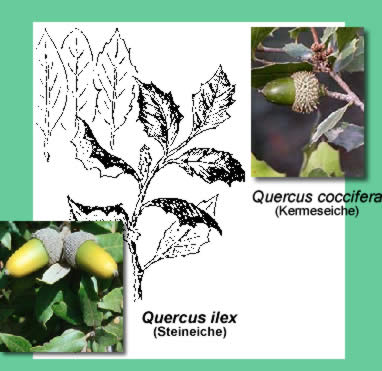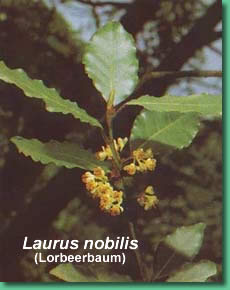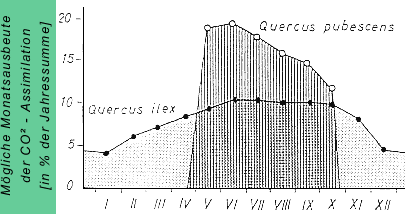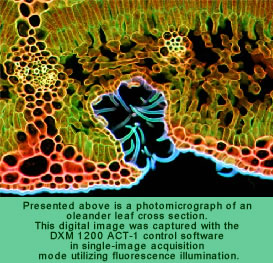| |
 |
 |
 |
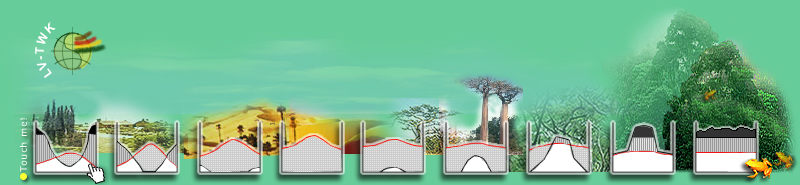 |
|
Vegetationsökologie
Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)
|
| |
|
sEp
|
|
ZM30
|
|
|
|
S.
C2
|
Flora und Vegetation mediterraner Gebiete 1
 |
 Abb. C2-00:
Abb. C2-00:
 Arbutus
andrachne
(Erdbeerbaum) - links - Arbutus
andrachne
(Erdbeerbaum) - links -
 Quercus
coccifera
(Kermeseiche) - rechts - Quercus
coccifera
(Kermeseiche) - rechts -
als typische Vertreter ost-mediterraner Vegetation. |
 |
 |
| |
|
 |
Gliederung der klimazonalen Flora & Vegetation |
| |
|
 |
Die
Gliederung der Winterfeuchten Subtropen bzw. des
ZB IV nach
Walter & Breckle (1991: 31) ergibt folgende Biomgruppen:
- Die Paläarktische
Biomgruppe des Mittelmeerraumes (als Teilgebiet der Holarktis
/ Eurasien - N-Afrika) kann in ein
- Westmediterranes
Biom (maritim getönt) mit Macchie und Garrigue und in
ein
- Ostmediterranes
Biom (kontinental getönt) mit Macchie, Phrygana und Batha
unterteilt werden.
- Die Nearktische
Biomgruppe in Californien (als Teilgebiet Holarktis / N-Amerika)
kann in ein
- Typisches
Biom, dem Chaparral, ein
- Hygrisches
Biom, dem Oak Woodland, und in ein
- Xerisches
Biom, dem Coastal Shrub, unterteilt werden.
- Die Neotropische
Biomgruppe
 in
Chile (als Teilgebiet der Neotropis / S-Amerika) besteht
aus nur einem in
Chile (als Teilgebiet der Neotropis / S-Amerika) besteht
aus nur einem
- Biom
der Hartlaubvegetation in Mittelchile, dem Matorral.
- Die Capensische
Biomgruppe in S-Afrika (als Teilgebiet der Paläotropis
/ SW-Afrika) besteht aus nur einem
- Biom
des Fynbos, der typischen Vegetation im Kapland.
- Die stark
isolierte Biomgruppe der Australis kann in ein
- Biom
der Hartlaubvegetation in SW-
 Australien
und in ein Australien
und in ein
- Biom
der Hartlaubvegetation in S-Australien unterteilt werde.
|
| |
|
 |
   Winterregengebiete
zählen mit einem Artenmaximum von über 2.000 (teilweise 3.000 bis 4.000 Arten pro 10.000km² nach den Immerfeuchten Tropen (5.000 Arten) zu den artenreichsten Regionen der
Erde. Die höchste Artenvielfalt pro Fläche findet sich im kleinen südafrikanischen Winterregengebiet (Capensis). Die Gesamtzahl der dort vorkommenden Gefässpflanzen liegt
bei über 6.000 und damit rund dreimal so hoch wie auf vergleichbaren Flächen tropischer Regenwälder (nach SCHULTZ, 2000). Winterregengebiete
zählen mit einem Artenmaximum von über 2.000 (teilweise 3.000 bis 4.000 Arten pro 10.000km² nach den Immerfeuchten Tropen (5.000 Arten) zu den artenreichsten Regionen der
Erde. Die höchste Artenvielfalt pro Fläche findet sich im kleinen südafrikanischen Winterregengebiet (Capensis). Die Gesamtzahl der dort vorkommenden Gefässpflanzen liegt
bei über 6.000 und damit rund dreimal so hoch wie auf vergleichbaren Flächen tropischer Regenwälder (nach SCHULTZ, 2000).
Die hohe Artenvielfalt
der Landschaften an der Mittelmeerumrandung (und nach Osten darüber
hinaus) ist auch Resultat bereits sehr früh wirksam werdender anthropo-zoogener
Einflüsse, welche z.B. in  Mitteleuropa Mitteleuropa
 16K zu einem starken Anstieg der Artenzahlen
(Archäophyten und Neophyten) geführt haben.
16K zu einem starken Anstieg der Artenzahlen
(Archäophyten und Neophyten) geführt haben.
|
|
|
 |
|
| |
|
| |
|
 |
Physiologie & Morphologie |
| |
|
 |
Die
in den Subtropischen Winterregenzonen dominierenden Immergrünen
Baum- und Straucharten der o.g. Florenreiche und Biomgruppen, die
sich aus deren
unterschiedlichen Pflanzenfamilien zusammensetzen, (vgl.  Konvergenz)
- besitzen oft kleine mehrjährige Blätter, die sich durch Konvergenz)
- besitzen oft kleine mehrjährige Blätter, die sich durch
 Hartblättrigkeit
bzw. Skleropyllie auszeichnen.
Hartblättrigkeit
bzw. Skleropyllie auszeichnen.
Die Blätter besitzen sklerenchymatische Verstärkungen bzw. Aussteifungen (quasi Stützgewebe, vgl. unten!), welche nach Wasserverlust
das Welken selbst nach starkem Rückgang des Turgors  bzw. osmotischen Drucks
bzw. osmotischen Drucks  verhindern (siehe auch unten!).
verhindern (siehe auch unten!).
|
| |
|
| |
Wie in allen anderen Vegetationszonen, passt sich auch hier der Vegetationsrhythmus dem Klimarhythmus an. Entscheidend
sind immer die Wasserverfügbarkeit und die Temperaturen (Max. - Min.). |
| |
|
| |
Produktionsleistungen der Immergrünen werden auch während der günstigen Wintermonate erbracht. Sie sind
auf sonnenexponierten Standorten jedoch während der Sommermonate niedriger als bei Sommergrünen, d.h. z.B. laubabwerfenden Bäumen. |
| |
|
| |
Diese Vegetation verträgt jedoch auch kurze und schwache Fröste, vor allem jene Taxa, welche noch in die sub-mediterrane
Zone reichen. |
| |
|
 |
Die
klimazonale Vegetation
der Subtropischen Winterregengebiete im engeren Sinne
wird durch  xeromorphe
Immergrüne
Hartlaubwälder charakterisiert,
vor allem durch xeromorphe
Immergrüne
Hartlaubwälder charakterisiert,
vor allem durch  Xerophyten
in der sogenannten 'eu-mediterranen'
küstennahen Zone. Xerophyten
in der sogenannten 'eu-mediterranen'
küstennahen Zone.
Die Vegetation ist dort:
- hoch
resistent gegen Trockenheit, um die Sommerdürre zu überstehen
(wenigstens einen Monat),
- hoch
resistent gegen Beweidung, was zu den typischen
 mediterranen
mosaikartigen Gebüschformationen führt. mediterranen
mosaikartigen Gebüschformationen führt.
Phanerophyten
und Chamaephyten sind häufig:
- extrem
ausschlagfähig nach Schneitelung,
- und
nicht besonders
 feuerempfindlich.
Periodische Feuer können oft förderlich für die Ausbreitung
von
feuerempfindlich.
Periodische Feuer können oft förderlich für die Ausbreitung
von  Xerophyten
sein (Erhöhung der Keimungswilligkeit oder sogar Bedingung für
Keimung). Xerophyten
sein (Erhöhung der Keimungswilligkeit oder sogar Bedingung für
Keimung).
|
| |
|
| |
Je länger
die Trockenperiode (z.B. im unmittelbaren Küstenbereich = eu-mediterrane
Zone), desto grösser ist der Anteil hartlaubiger Arten, sogenannter
 Xerophyten,
zu denen auch die
Xerophyten,
zu denen auch die  Sklerophyllen
zählen (z. B. Quercus ilex und Qu. coccifera
- siehe unten!). Sklerophyllen
zählen (z. B. Quercus ilex und Qu. coccifera
- siehe unten!). |
| |
|
| |
|
| |
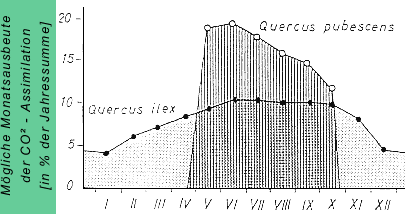
 Abb. C2-01:
Abb. C2-01:
Die prozentuale Verteilung der Produktion auf die einzelnen
Monate im Jahr, bei:
immergrünen
 Quercus
ilex (Steineiche) und Quercus
ilex (Steineiche) und
sommergrünen Eichen
 Quercus pubescens
(Flaumeiche)
Quercus pubescens
(Flaumeiche)
Über die Absolutwerte ist hier nichts ausgesagt, die Gesamtproduktion ist stets bei guter Wasserversorgung bei Qu. pubescens
höher, bei Sommerdürre kleiner als bei Qu. ilex.
(nach Larcher, aus Walter & Breckle 1991:91)
|
| |
|
| |
Im Unterschied zu
den  Malakophyllen
besitzen Malakophyllen
besitzen  Sklerophyten
harte, durch Sklerenchyme (Festigungsgewebe) verdickte und mit einer dicken
Kutikula Sklerophyten
harte, durch Sklerenchyme (Festigungsgewebe) verdickte und mit einer dicken
Kutikula  versehene Blätter (siehe Abb. unten!),
die zur Einschränkung der Verdunstung wachsartige und harzige Deckschichten
aufweisen.
versehene Blätter (siehe Abb. unten!),
die zur Einschränkung der Verdunstung wachsartige und harzige Deckschichten
aufweisen.
Während des Sommers
werden häufig kleine xeromorphe Blätter ausgebildet -
Blattdimorphismus -, grosse Blätter
mit regem Gasaustausch während des Winters und kleine Blätter
während des trockenen Sommers), welche während der Trockenzeit
erhalten bleiben. Bei dem Stinkstrauch ( Anagyris
foetida) erfolgt mit dem Beginn der Dürrezeit sogar ein
vollständiger Blattabwurf. Anagyris
foetida) erfolgt mit dem Beginn der Dürrezeit sogar ein
vollständiger Blattabwurf.
Die  Skleropyllen
(Hartblättrigen) verringern dadurch während der Dürrezeit
ihre Wasserabgabe wesentlich bei gleichzeitiger Steigerung der Zellsaftkonzentration
(der potentielle osmotische Druck während der Dürrezeit steigt
von etwa 21 atm um 4-5 atm an, d.h. die Wasserbilanz wird nicht wesentlich
gestört und die Hydratur des Protoplasmas wird kaum verringert, Walter
1973, S.130). Skleropyllen
(Hartblättrigen) verringern dadurch während der Dürrezeit
ihre Wasserabgabe wesentlich bei gleichzeitiger Steigerung der Zellsaftkonzentration
(der potentielle osmotische Druck während der Dürrezeit steigt
von etwa 21 atm um 4-5 atm an, d.h. die Wasserbilanz wird nicht wesentlich
gestört und die Hydratur des Protoplasmas wird kaum verringert, Walter
1973, S.130).
Ihre Hydrostabilität ist zusätzlich in der Fähigkeit zu sehen, während der Zeiten mit Wassermangel durch den Verschluss
der Stomata (Spaltöffnungen) die Wasserverluste stark zu drosseln.
Die typisch mediterranen Sklerophyllen dieser Klimazone wurden im Laufe der neueren Geschichte (durch Ausweitung der Landwirtschaft) auf
Standorte mit geringer Bodenauflage und damit geringer Wasserversorgung (und längerer Dürrezeit) verdrängt. Auf diesen Ungunststandorten kann ihre Zellsaftkonzentration bis
auf 30-50 atm ansteigen.
|
|
|
 |
|
| |
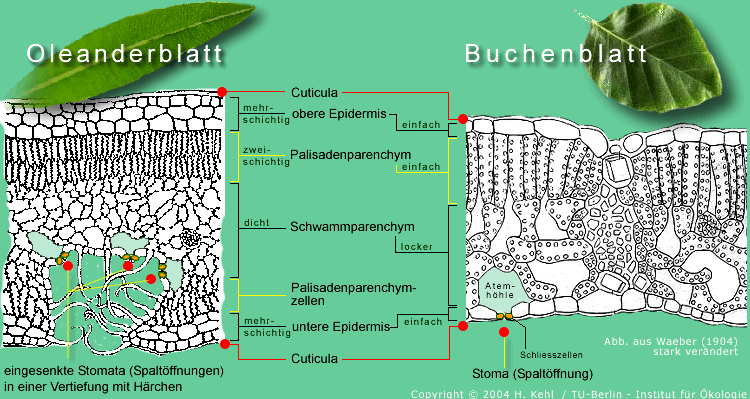 |
| |
|
| |
 Abb. C2-02:
Abb. C2-02:
Blatt von  Nerium oleander (aus Strassburger
1967: 170) mit einem Buchenblatt -
Nerium oleander (aus Strassburger
1967: 170) mit einem Buchenblatt - Fagus
sylvatica - (aus Waeber
1904: 281) als vergleichendes Beispiel (siehe auch unten rechts
die Mikro-Aufnahme eines Oleander-Blattquerschnittes). Fagus
sylvatica - (aus Waeber
1904: 281) als vergleichendes Beispiel (siehe auch unten rechts
die Mikro-Aufnahme eines Oleander-Blattquerschnittes).
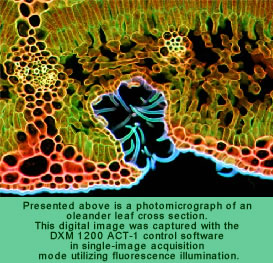  Die
xeromorphen Pflanzen der Subtropen, z. B. Die
xeromorphen Pflanzen der Subtropen, z. B. Nerium oleander
besitzen im Gegensatz zu Laubbäumen temperater Regionen eine
mehrschichtige Epidermis, sowie ein zweischichtiges Pallisadenparenchym.
Die Spaltöffnungen bei
Nerium oleander
besitzen im Gegensatz zu Laubbäumen temperater Regionen eine
mehrschichtige Epidermis, sowie ein zweischichtiges Pallisadenparenchym.
Die Spaltöffnungen bei
 Nerium
oleander
sind verengt und liegen versenkt in der Blattunterseite
oder sind durch Überwölbungen derselben mit Haarfilzen
ausgestattet. Nerium
oleander
sind verengt und liegen versenkt in der Blattunterseite
oder sind durch Überwölbungen derselben mit Haarfilzen
ausgestattet.
 Durch
diese Versenkungen können Wasserdampf-gefüllte,
windstille Räume geschaffen werden, wodurch das Sättigungsdefizit
der darin enthaltenden Luft herabgesetzt und dadurch die Verdunstung
eingeschränkt wird. Durch
diese Versenkungen können Wasserdampf-gefüllte,
windstille Räume geschaffen werden, wodurch das Sättigungsdefizit
der darin enthaltenden Luft herabgesetzt und dadurch die Verdunstung
eingeschränkt wird.
 Abb.
C-2/03:
Abb.
C-2/03:
Digitale Mikroaufnahme eines Oleander - Blattquerschnittes mit
versenkter Spaltöffnung, ausgestattet mit Haarfilz (bläulich)
www.source
(and copyright of the image):  Nikon
MicroscopyU Nikon
MicroscopyU
[date of access: 09.04, leider mittlerweile offline]
|
|
|
 |
|
| |
|
| |
|
| |
Im Gegensatz zu
hydrostabilen Sklerophyllen sind die
 Malakophyllen,
das sind Weichblättrige, oft mit einem dichten Filz von Haaren,
z.B.
Malakophyllen,
das sind Weichblättrige, oft mit einem dichten Filz von Haaren,
z.B.
 Cistus
villosus bzw. C.creticus (verschiedene Zistrosen / Rock Roses), Cistus
villosus bzw. C.creticus (verschiedene Zistrosen / Rock Roses),
 Cistus
laurifolius (lorbeerblättrige Zistrose), Cistus
laurifolius (lorbeerblättrige Zistrose),
 Thymus
vulgaris (gemeiner Thymian), Thymus
vulgaris (gemeiner Thymian),
Viburnum
spec. (Schneeball)
sehr hydrolabil.
- nach WALTER 1968: 91 -
Bei sommerlichen
Anstiegen der Zellsaftkonzentration (bis auf 40 atm) tritt bei ihnen
eine Reduzierung der transpirierenden Blattfläche ein, indem ein
grosser Teil der Blätter abgeworfen wird. Oft verbleiben nur die
Knospen.
Von WALTER
& BRECKLE (1991: 4) werden
 Laurus
nobilis (der Lorbeer), Laurus
nobilis (der Lorbeer),
 Prunus
laurocerasus (Kirschlorbeer), verschiedene Prunus
laurocerasus (Kirschlorbeer), verschiedene
 Rhododendron
- Arten,
die beiden verschiedenen Erdbeerbaum-Arten Rhododendron
- Arten,
die beiden verschiedenen Erdbeerbaum-Arten
 Arbutus
andrachne (ostmediterran) oder Arbutus
andrachne (ostmediterran) oder
 Arbutus
unedo (westmediterran), Arbutus
unedo (westmediterran),
 Buxus
sempervirens (der Buchsbaum), Buxus
sempervirens (der Buchsbaum),
 Ilex
aquifolium / I. colchicum (die Stechpalme) sowie Ilex
aquifolium / I. colchicum (die Stechpalme) sowie
 Hedera
helix (der Efeu) Hedera
helix (der Efeu)
zu den Relikten der
Tertiärzeit gezählt. Die Lauriphyllen
mit sklerophyllen Merkmalen stellen ein Übergangsstadium
zwischen Malakophyllen und Sklerophyllen dar, wobei der Übergang
zwischen Laurophyllie und Sklerophyllie fliessend ist.
Bei den oben genannten
lauriphyllen Arten werden Reduzierungen der Blättfläche nur
selten beobachtet, denn ihre natürlichen Standorte liegen in
der Regel im Schatten der (zumeist) feuchteren Nordhänge ohne ausgesprochene
Sommerdürre.
In der Literatur werden  Laurus
nobilis und die beiden Laurus
nobilis und die beiden  Arbutus
unedo sowie Arbutus
unedo sowie  Arbutus
andrachne in der Regel eher zu den Sklerophyllen gezählt
(LESER, 1994, SCHULTZ, 2000). Arbutus
andrachne in der Regel eher zu den Sklerophyllen gezählt
(LESER, 1994, SCHULTZ, 2000).
Die Verbreitung
typisch mediterraner Arten wird polwärts in
der Regel durch Winterkälte (kurzfristig sehr tiefe Temperaturen
oder langanhaltende Fröste) und äquatorwärts durch zunehmende
Trockenheit (aber auch winterliche Frosteinbrüche) begrenzt.
Generell ist eine
äussere Abgrenzung mediterraner Gebiete mit Hilfe der Vegetation
nur (noch) schwer möglich, da Kultur- und Wirtschaftsentwicklung
zu starken Degradierungen geführt haben bzw. floristischen Mediterranisierung
angrenzender Klimazonen. So reichen heute einige wenige frostunempfindliche
Taxa weit in die sub-mediterrane Zone.
Darüber hinaus
sind klare Grenzziehungen (auch aus pflanzengeograpischer Perspektive)
nahezu unmöglich, da die pflanzlichen Populationen der Grenzgebiete
weit ineinandergreifen. Thomas RAUS (1982) stellt
daher zu Recht für die Balkan-Halbinsel fest: "The problem of
delimination of Mediterranean and non-Mediterranean areas on the Balkan
Peninsula .... seems to be far from its solution".
|
 |
|
| |
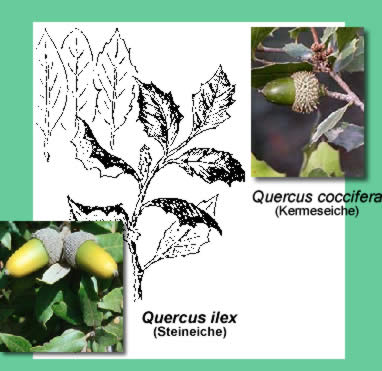 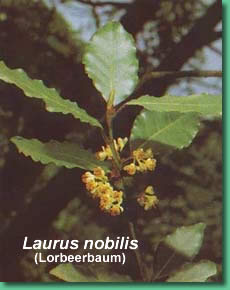 |
| |
 Abb. C2-04 (mit
Quercus coccifera und Quercus ilex) und
Abb. C2-04 (mit
Quercus coccifera und Quercus ilex) und
 Abb. C2-05
(mit
Laurus nobilis)
Abb. C2-05
(mit
Laurus nobilis)
|
| |
| |